Wegen Christoph Maria Herbst ins Kino – mit Nico Randel im Herzen wieder raus
In „Ganzer halber Bruder“ (Casting: Sabine Schwedhelm, Menschen mit Beeinträchtigung: Sven Harjes) steht das Thema Abwesenheit im Mittelpunkt – und doch wird die Geschichte als Komödie erzählt. Im Fokus stehen echte Begegnungen, ein inklusives Ensemble und eine berührende Stiefbruder-Beziehung zwischen Thomas und Roland (Christoph Maria Herbst und Nico Randel), die gesellschaftliche Erwartungen in Frage stellen.
Als Thomas aus dem Gefängnis entlassen wird, erfährt er, dass er ein wertvolles Haus geerbt hat. Die Sache hat nur einen Haken: Sein Halbbruder Roland hat dort lebenslanges Wohnrecht. Thomas nistet sich dennoch ein und setzt sein gesamtes manipulatives Repertoire ein, um den ungeliebten Mitbewohner aus dem Haus zu drängen. Doch Roland erweist sich als überraschend willensstark.
www.wildbunch-germany.de/ganzer-halber-bruder © 2025 Neue Schönhauser Filmproduktion/Wild Bunch Germany
Schon zuvor begegneten sich die Beteiligten bei „CAST ME IN“ 2022 in Köln: Dort begegneten sich Nico Randel und Sven Harjes. Letzterer verantwortete gemeinsam mit Sabine Schwedhelm später das Casting, während Clemente Fernandez-Gil sich noch im Drehbuch-Prozess befand.
Carina Kühne und Tina Thiele sprachen mit Drehbuchautor Clemente Fernandez-Gil über den Entstehungsprozess von Buch und Film, über Haltung und Erfahrung sowie über die Perspektiven, die er sowohl als Autor als auch als Vater eines Sohnes mit Trisomie 21 einbringt.
Die folgenden Fragen richten sich daher an den Drehbuchautor in beiden Rollen: als Autor und als Mensch, der sich für Inklusion und Vielfalt in der Filmbranche vor und hinter der Kamera stark macht.
Carina: Oft spielen Darsteller*innen mit Down-Syndrom Opferrollen. Roland ist kein Opfer. Ich finde sehr gekonnt dargestellt, dass er zwar einiges nicht kann, aber trotzdem sehr selbstständig ist und mit entsprechender Unterstützung alles schafft. Was möchtest Du damit zum Ausdruck bringen?
Ich habe auch schon vor über 25 Jahren am Theater mit Darsteller*innen mit Down-Syndrom gearbeitet und habe einen Sohn mit Down-Syndrom. Mir fiel auf, dass Menschen mit Behinderung viel mehr Potenzial haben, als die Gesellschaft ihnen zusteht. Oft werden ihnen Dinge abgenommen, die sie eigentlich selbst können. Das Umfeld macht es sich da sehr bequem, denn für die Selbstständigkeit muss man natürlich erstmal relativ viel investieren. Das sehe ich an meinem jetzt 14-jährigen Sohn: Bis er etwas wirklich gut kann, muss ich das, sagen wir mal, 50-mal mit ihm probieren, während das bei anderen Jugendlichen vielleicht nach dem fünften Mal schon klappt. Ich glaube, dass es vielen Leuten zu anstrengend ist, Dinge so lang anzuleiten und zu wiederholen und dass sie es dann lieber selbst schnell erledigen.
Mir war wichtig, diese Zwickmühle darzustellen und von einem jungen Mann zu erzählen, der im Grunde genommen eine große Selbstständigkeit hat: Er hat einen Beruf, er treibt gerne Sport, das macht er alles selbst. Insofern ist „Rolands“ Situation für mich ein Idealbeispiel gewesen. Ich wollte zeigen, dass es das gibt, dass es möglich ist. Wahrscheinlich ist es doch eher die Ausnahme als die Regel, aber es ist durchaus denkbar. Mir war es wichtig, eine Figur zu zeigen, bei der der Zuschauer merkt: „Ah ja, okay, ich wusste gar nicht, dass Menschen mit Down-Syndrom selbstständig leben können!“
Tina: Nehmen wir mal Deinen Sohn als Inspiration für Deine Arbeit. Gab es ein Erlebnis, das Dich besonders geprägt hat, durch eben die Tatsache, dass Dein Sohn nicht in das heterogene Normal fällt? Fließt hier auch etwas von Dir als Privatperson in Deine Arbeit ein?
Es gibt natürlich viele, aber ein seltsamer und gleichzeitig sehr besonderer Moment ist mir in Erinnerung geblieben. Matti war vielleicht vier Jahre alt, wir waren im Urlaub in Portugal und sind in Lissabon mit der Straßenbahn gefahren. Ich saß auf dieser Bank und hatte Matti auf dem Schoß. Gegenüber von uns setzte sich ein Mann, der schon relativ verlebt aussah, sehr in sich versunken und fast apathisch. Er blickte auf, sah Matti, fing an zu strahlen und hat mir dann mit Zeichen zu verstehen gegeben, dass er eine Art Beziehung zu Matti hat. Ich meine verstanden zu haben, dass er selbst eine*n Verwandte*n mit Down-Syndrom hat. Er war plötzlich hellwach, ganz präsent und klar, um uns seine Sympathie auszudrücken, das hat mich total gerührt.
Carina: Mir ist aufgefallen, dass Roland sich sehr leicht provozieren lässt und manchmal ausrastet, wenn er an seine Grenzen stößt. Sind das Deine Erfahrungen oder geht es dabei darum, Spannung zu erzeugen?
Es stimmt, einerseits wird es spannender, wenn Roland aufbrausend reagiert. Andererseits war mir wichtig, ein Bild von einem Menschen mit Down-Syndrom zu zeichnen, das vom Klischee abweicht. Oft werden sie immer freundlich dargestellt, lächeln immer, haben viel Spaß und sind immer glücklich. Bei Roland war es mir wichtig zu zeigen, dass das Leben mit Down-Syndrom vielschichtiger ist.
In der Geschichte ist er auch der Einzige, der spürt, dass dieser Thomas nicht ganz ehrlich ist, während die anderen nichts davon merken. Seine Mutter hat „Roland“ eingebläut, dass man keine Fremden reinlassen darf und das ist eine Regel, an die er sich hält. Vielleicht lässt er sich auch wegen dieser Regel nicht von Thomas täuschen, weil er denkt: „Nein, ich weiß, wie ich mich Fremden gegenüber zu verhalten habe und dieser Thomas ist ein Fremder.“ Er ist sehr misstrauisch, und nur wir wissen zunächst, dass er damit recht hat.
 |
 |
| Roland erweist sich als willensstark © 2025 Neue Schönhauser Filmproduktion/Wild Bunch Germany | Der neue halbe Bruder Thomas stellt sich vor © 2025 Neue Schönhauser Filmproduktion/Wild Bunch Germany |
Carina: Gab es Berührungsängste zwischen Christoph Maria Herbst und Nico Randel?
Christoph war total interessiert an der Rolle, aber konnte nicht einschätzen, worauf er sich einlässt. Am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, Christoph ist ein anderes Tempo am Set gewohnt. Da muss man erstmal Geschwindigkeit rausnehmen. Wir hatten „nur“ 30 Drehtage und haben uns trotzdem gefragt, ob alles klappen wird und ob alle durchhalten. Es gab keine Berührungsängste mit Nico, sondern eher mit der Situation, denn so häufig sind 30 Drehtage mit einem Darsteller mit Down-Syndrom in Deutschland noch nicht gemacht worden.
Tina: Habt Ihr chronologisch gedreht?
Nein, das ging aus produktionstechnischen Gründen nicht. Wir haben Set für Set – also im Haus, der Wäscherei und so weiter – nacheinander abgedreht. Für Nico war es am Anfang nicht leicht zu verstehen, aber wir haben ihm schon vorher erklärt, wie drehen funktioniert. Er hatte auch eine Coachin an seiner Seite, die ihn immer wieder in die Szene geholt hat. Beim Filmschauspielern muss man wirklich im Moment sein und das kann Nico sehr gut.
Carina: Es gibt eine Szene im Bus, in der er von einer Gruppe Jugendlicher ausgelacht wird. Roland bleibt da ganz cool, seinem Halbbruder Thomas wird es zu viel. Was war der Sinn dieser Szene?
Es kommt glücklicherweise nicht so oft vor, dass die „böse“ Gesellschaft Menschen mit Down-Syndrom verstößt. Aber es passiert schon und ich wollte das auch benennen und zeigen. Ich finde die Szene selbst auch nicht angenehm. Witzigerweise spielt mein ältester Sohn einen von den pöbelnden Jungs. Wir haben die Szene sehr oft geprobt und ja, die Szene ist schmerzhaft, aber manchmal muss man in Filmen auch unangenehme Dinge zeigen. Trotzdem wollte ich kein Drama von einem Menschen mit Down-Syndrom erzählen, dem es schlecht geht und der gerettet werden muss. Aber es gibt natürlich Menschen, die sich über Behinderungen lustig machen. Wenn man das einmal umdreht und zeigt, dann ändern diese Leute vielleicht ihre Meinung.
Carina: Ich fand Nico hat in der Szene, in der die Mutter stirbt, ganz großartig gespielt. Kannst Du ein bisschen darüber erzählen?
Für Nico war das schon beim ersten Lesen die allerwichtigste Szene. Er hat dann im Grunde genommen das getan, was gute Schauspieler machen: Er hat gar nicht gespielt, es kam so aus ihm raus. Natürlich hatte er ein paar Anweisungen, aber im Grunde genommen hat er gespielt, ohne groß zu überlegen. Die Szenen, die im Krankenhaus spielen, erzählen ja von den emotionalen Fähigkeiten und Unfähigkeiten der beiden Halbbrüder. Thomas ist gar nicht in der Lage, überhaupt in dieses Krankenzimmer hineinzugehen. Schließlich gelingt es Roland, ihn an die Hand zu nehmen und hineinzuführen. In dieser Szene stellt sich die Frage, wer von den beiden eigentlich Förderbedarf hat.
Ähnlich ist es in der Szene mit dem Brief der Mutter an Thomas. Dieser Brief repräsentiert das Päckchen der unbewältigten Vergangenheit, das Thomas mit sich herumträgt. Weil für sich genommen ist er gar nicht so falsch oder böse, er hat einfach bestimmte Sachen nicht erfahren können. Er hat keine Familie, keine Freunde, er hat im Grunde genommen immer nur gelernt, sich durchzuboxen, gemein zu sein und auf eigenen Vorteil zu achten. Und dieser Brief, den er am Anfang nicht lesen kann, tut dann natürlich irgendwann, wenn er bereit ist, seine Wirkung.
Mir ging es immer darum zu hinterfragen, wer in dieser Geschichte eigentlich kompetent ist, denn Roland macht Urlaub, geht arbeiten, hat sein Haus, seinen Sport, sein soziales Gefüge. Das alles hat Thomas nicht. Er ist der Sozialkrüppel, und er ist übrigens auch derjenige, der uns gesellschaftlich mehr kostet. Ein Tag im Knast kostet ungefähr 350 Euro. Wenn er zwei Jahre drin war, kann man sich überlegen, wie viel er den Steuerzahler schon gekostet hat. Die Wirtschaftlichkeit ist ja auch immer ein Argument, das gegen Behindertenwerkstätten angeführt wird. Aber wenn man da mal genau hinguckt, weiß ich nicht, wie viele Leute staatliche Hilfe in Anspruch nehmen oder gefördert worden sind auf irgendeine Art und Weise durch staatliche Gelder.
Carina: Menschen mit Down-Syndrom sind ja sehr verschieden und unterschiedlich leistungsfähig. Sollte man das nicht auch zum Ausdruck bringen?
Ja, das finde ich total wichtig. Ich hätte gerne mehr Darsteller*innen mit Down-Syndrom in dieser Geschichte gehabt, aber es war aufwändig, Roland überhaupt zu besetzen. Es gab noch eine ganze Szene, die haben wir nicht mehr gefilmt. Sie zeigt eine Party im Wohnheim, und darin sind viel mehr Menschen mit Beeinträchtigung. Aber wir haben es nicht auf die Beine gestellt bekommen. Das Buch war dann ohnehin etwas zu lang, und wir haben uns dann entschieden, diese Szene zu streichen, da sie einfach sehr schwierig umzusetzen war. Es war eine Zeit- und auch eine Geldfrage. Aber es stimmt, natürlich ist es wichtig, zu zeigen, wie unterschiedlich Menschen mit Down-Syndrom sind.
 |
 |
| Echte halbe Brüder: Thomas und Roland © 2025 Neue Schönhauser Filmproduktion/Wild Bunch Germany | Zwei ungleiche Halbbrüder teilen die gleiche Leidenschaft © 2025 Neue Schönhauser Filmproduktion/Wild Bunch Germany |
Carina: Kannst Du Dir vorstellen, Drehbücher zu schreiben, in denen Darsteller*innen mit Trisomie 21 mitspielen, ohne dass die Behinderung ein Thema ist?
Das ist ein großes Ziel, das wir alle verfolgen sollten. Das hat auch was damit zu tun, wie Produktionen, Drehbuchautor*innen und Regisseur*innen über zu besetzende Rollen nachdenken. Ich habe ja ganz bewusst Down-Syndrom zum Thema gemacht. Aber ich glaube, man muss unbedingt daran arbeiten, dass Rollen – beispielsweise ein Pfleger im Krankenhaus, der eine Funktion und ein paar Sätze hat – auch mal mit Darsteller*innen mit Down-Syndrom besetzt werden.
In Deutschland sieht man Menschen mit Behinderungen weniger, weil die Werkstatt- und Wohnheimsysteme wie Paralleluniversen sind. Die Bewohner*innen sind sehr für sich und treten im öffentlichen Leben kaum in Erscheinung. Deshalb traut man ihnen auch die Normalität gar nicht zu, man kommt einfach nicht auf die Idee. Dabei gibt es tausend Möglichkeiten, diese Menschen sichtbar zu machen.
Carina: Aus Angst vor niedrigen Einschaltquoten und weil viele davon ausgehen, dass die Darstellung von Behinderungen in Filmen vom Publikum abgelehnt wird, trauen sich viele Filmemacher*innen oft nicht, neue Wege zu gehen. Wie schwer war es, das Thema Inklusion durchzusetzen?
Ja, das war gar nicht so leicht. Sender und Geldgeber*innen gehen häufig davon aus, dass sich nicht viele Leute für das Thema interessieren. Ich finde: Genau deshalb muss man das Interesse dafür erzeugen. Unser Film ist ein Unterhaltungsfilm im besten Sinne: er ist niedrigschwellig, ganz schlicht und einfach und direkt. Es ist kein Nischenfilm für Leute mit Down-Syndrom oder Leute, die sich mit Down-Syndrom auskennen. Im Gegenteil, er ist eher für Leute, die nichts davon wissen und die denken: „Down-Syndrom kenne ich nicht, aber diesen Christoph Maria Herbst finde ich interessant, den gucke ich mir an.“ Ich fände es großartig, wenn die Leute wegen Christoph Maria Herbst ins Kino gehen und mit Nico Randel im Herzen wieder rauskommen.
Carina: Ich wünsche mir Drehbuchautoren, die den Mut haben, spannende und abwechslungsreiche Geschichten zu schreiben. Auch Geschichten über den Alltag, Freundschaft, Liebe, Scheitern oder auch mal Kriminalität vielleicht sogar Mord?
Geschichten zeichnen sich durch die Fülle an Möglichkeiten aus, warum sollten Menschen mit Down-Syndrom nicht auch all diese Möglichkeiten haben? Es gab da mal einen inspirierenden Vorfall, den fand ich als Stoff für einen Film spannend: Es ist schon lange her, da hat in Berlin ein Mann mit Down-Syndrom versucht, eine Bank zu überfallen. Das hat nicht geklappt, aber ich habe mir sehr viele Gedanken dazu gemacht. Ich habe mich gefragt, warum er das versucht hat, wie man das erzählen könnte, ohne sich über ihn lustig zu machen. Wahrscheinlich hatte es total plausible Gründe, er hatte wahrscheinlich einfach keine Lust, arm zu bleiben, mit den 3,80 Euro in der Stunde, die er in einer Werkstatt verdienen kann. Aber dann stünde natürlich wieder das Thema Down-Syndrom im Vordergrund. Ich denke, es muss noch drei, vier gute Filme mit Menschen mit Down-Syndrom in den mit Hauptrollen geben, danach kann man wahrscheinlich den nächsten Schritt gehen und die Behinderung als Thema loslassen, um ganz andere Geschichten erzählen, Krimi, Action, was auch immer, alles was Spaß macht.
Im Film wird es ja auch kurz kriminell, als Thomas Roland zu einer Straftat überredet und dabei ausnutzt, dass Roland dafür nicht belangt werden kann. Falls sie erwischt würden, könnte er alles auf Roland schieben. Das ist eine witzige Diebestour, die die beiden da machen.
Thomas überlasst seinem Halbbruder das Steuer © 2025 Neue Schönhauser Filmproduktion/Wild Bunch Germany
Tina: Diversität wird in der Filmwelt viel diskutiert. Wie setzt Du Dich auch am Set dafür ein? Was muss sich dort vielleicht auch strukturell verändern, damit Deine Vision, Dein Drehbuch nicht nur inhaltlich stimmt, sondern auch die Form hat?
Also beim Dreh selbst erfordert das natürlich eine bestimmte Art von Flexibilität im Drehen. Man muss schauen, welche Belastungen möglich sind, wie lange man drehen kann. Dafür muss man die Person mit Beeinträchtigung im Vorfeld gut kennenlernen. Wir haben den Drehplan ein bisschen um Nico gebaut, um ihn zu schützen. Aber auch, um das Projekt zu schützen. Wir hatten keine Zweitbesetzung. Wenn er im Projekt abgesprungen wäre, wäre das Projekt gelaufen. Insofern muss man sich genau überlegen, welche zusätzliche Unterstützung die Person braucht. Oder, wenn es eine Person im Rollstuhl ist, welche Gegebenheiten am Set angepasst werden müssen. Solche Dinge muss man vorher einplanen, und das kostet immer Geld. Aber eine diverse Besetzung überhaupt zu ermöglichen, liegt auch in meiner Verantwortung, da die Besetzung im Buch anfängt. Ich muss darauf bestehen, dass Menschen mit einer bestimmten Beeinträchtigung oder Besonderheit besetzt werden und nicht durch jemanden ohne Beeinträchtigung ersetzt werden.
Carina: Leider traut man Darsteller*innen mit Trisomie 21 nicht viel zu und im Vordergrund steht meist die Behinderung und das Anderssein. Es gibt bestimmte Vorstellungen, wie ein Mensch mit Down-Syndrom auszusehen hat. Ich habe schon mehrmals die Erfahrung gemacht, dass ich eine Rolle nicht bekomme, weil ich angeblich nicht spreche wie ein Mensch mit Trisomie 21. Da frage ich mich: Geht es hier nur um meine Beeinträchtigung oder mich als Person?
Es ist natürlich absurd zu hören, man sei „nicht behindert genug“ für eine Rolle. Das zeigt, dass manche Produktionen oder Filmemacher*innen eine bestimmte, sehr verengte Vorstellung davon haben, wie Behinderung auszusehen hat. Das haben sie wahrscheinlich nicht nur, wenn sie eine Rolle mit Down-Syndrom besetzen müssen, sondern auch in anderen Bereichen. Mit solch engen Vorstellungen, wie etwas aussehen sollte, ist man auch nicht mehr offen für neue Eindrücke im Casting. Dann stellt sich mir die Frage, was will man überhaupt zeigen? Nur das Opfer? Will man Mitleid erregen?
Für die Rolle Roland waren ein paar Sachen wichtig: Zunächst musste er Down-Syndrom haben, außerdem muss er glaubwürdig Gewichtheben können. Das schränkt die Auswahl schon ein. Mir war auch wichtig, dass es ein Schauspieler ist, der aus eigenem Antrieb mitmachen möchte, der nicht überredet worden ist, denn 30 Drehtage benötigen Durchhaltevermögen. Das ist eigentlich eine Voraussetzung, die man auch an jemanden ohne Beeinträchtigung stellen würde. Ich kann eine gute Besetzung finden, die dann unter Umständen die Hauptrolle nicht tragen kann, weil es einfach zu hart oder zu anspruchsvoll ist.
Bei den Gewichten haben wir übrigens ein bisschen geschummelt, die waren nicht so schwer, wie behauptet. Sie mussten aber trotzdem ein ordentliches Gewicht haben, damit es beim Heben nicht falsch aussieht. Dafür hat Nico auch tüchtig trainiert.
Tina: Welche Rolle hast Du als Autor selbst? Bist Du eher Beobachter, Anstoß-Geber oder Brückenbauer?
Anstoßen und Brücken bauen gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut, weil ich glaube, dass man sich am Anfang eine Figur aussucht, von der man glaubt, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung mehr Aufmerksamkeit und Respekt verdient. Wenn man diese Figur versteht und kennenlernt, sieht, wie sie tickt, was sie erlebt, was sie ausmacht, was sie repräsentiert, gesellschaftlich und persönlich, kann man auch immer Rückschlüsse auf sich selbst ziehen. Wie anders bin ich, wie ähnlich bin ich? Gibt es Parallelen, gibt es große Unterschiede?
Tina: Arbeitest Du an einem neuen Projekt und darfst Du schon mal verraten, was es ist?
Ja, das hat tatsächlich auch etwas mit Inklusion zu tun, aber da geht es um eine Person, die eine Geschlechtsangleichung macht, eine Angleichung von Frau zu Mann. Wenn man es schafft, den Kampf einer solchen Person zu begreifen und nachzuvollziehen, dann hat man schon viel Empathie-Leistung erbracht. In unserer Zeit ist Trans-Sein ein großes Thema. Wie gehen wir mit Trans-Personen um? Momentan gibt es hier ja eine Rückwärtsbewegung, es wird schwieriger, auch international. Und das ist einfach ein Thema, das erzählenswert ist.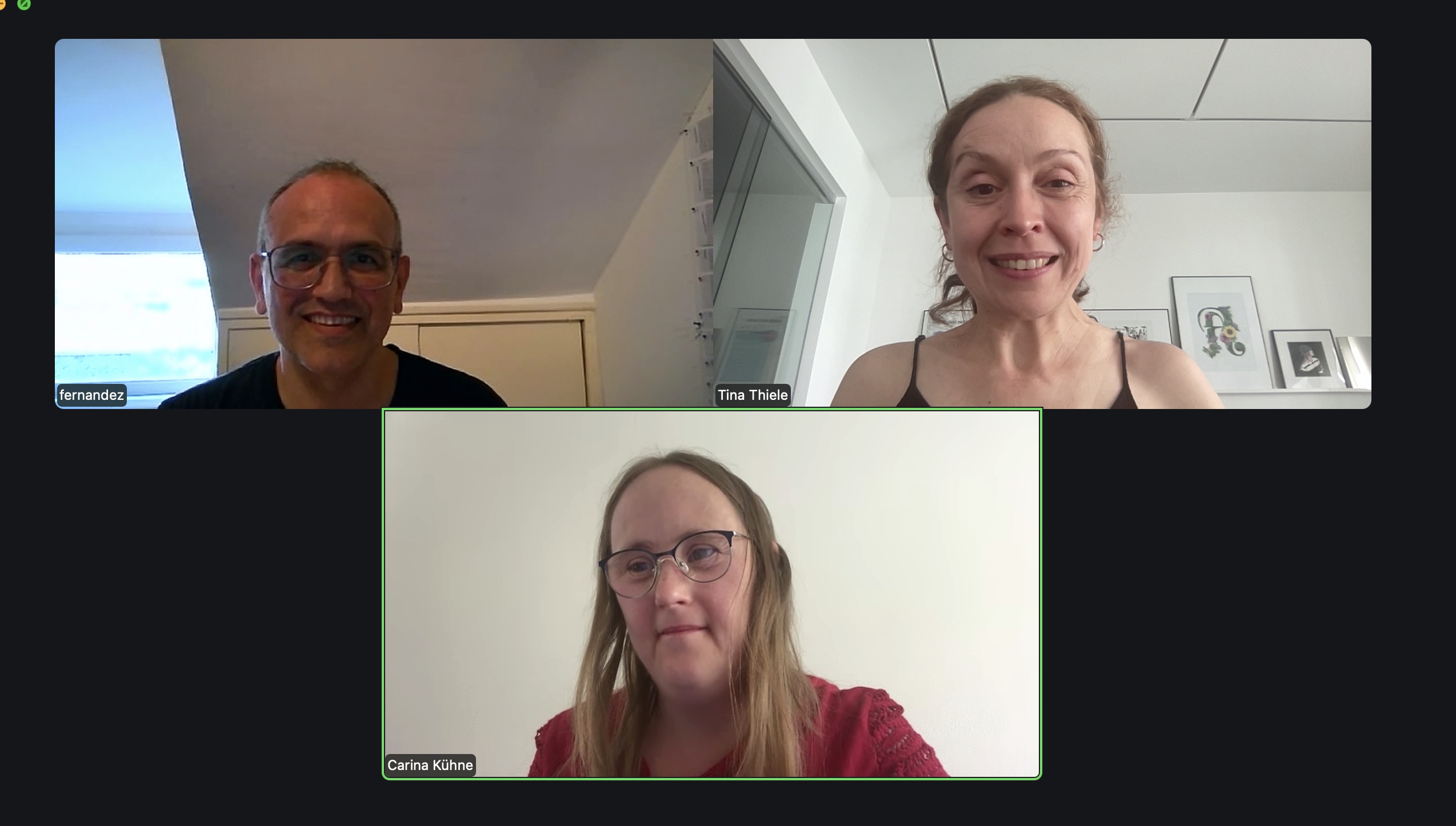
Das Gespräch mit Clemente Fernandez-Gil führten Tina Thiele und Carina Kühne, Ausarbeitung Carla Schmitt und Daniela Deffner.
Carina Kühne und Tina Thiele
Zum Seitenanfang Seite drucken


